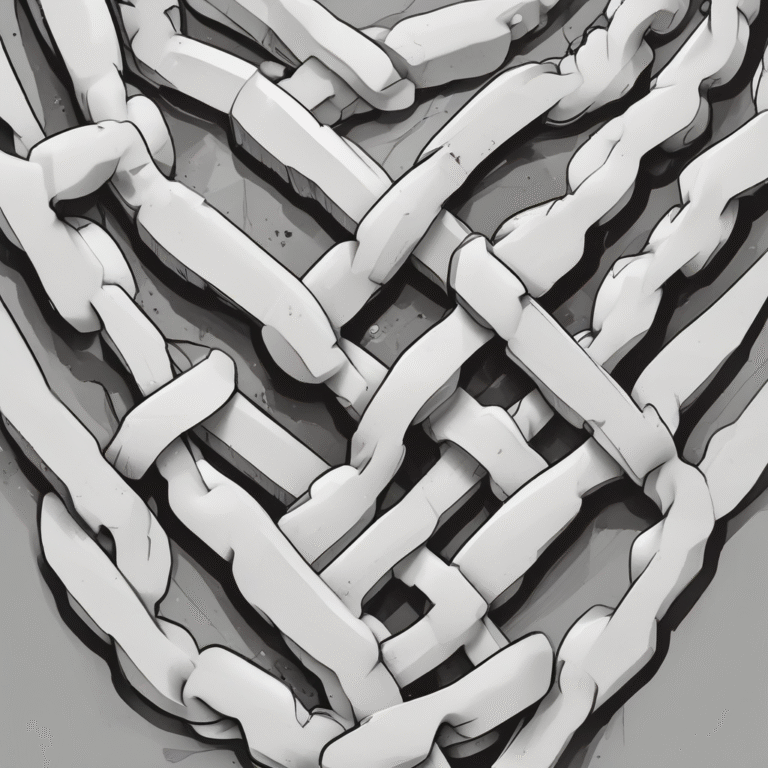EU-Richtlinien zur Nutzung von KI: Massive Kritik
Nachdem die EU ihren Verhaltenskodex zur Nutzung von KI als Ergänzung zum EU-KI-Gesetz veröffentlicht hat, prasselte die Kritik aus allen Richtungen auf die neuen Richtlinien herab — mit einer Durchsetzungsfrist von nur zwei Wochen.
Der Verhaltenskodex
Mit dem General Purpose AI Code of Practice (GPAI-Verhaltenskodex) hat die EU ihren ersten Verhaltenskodex zur Regulierung von allgemeiner KI veröffentlicht. Dieser soll die Konformität mit dem EU-KI-Gesetz erleichtern. Die Richtlinien treten am 2. August 2025 in Kraft und sollen ab 2026 in der Praxis umgesetzt werden. Diese Richtlinien sind jedoch umstritten und wurden von Lobbygruppen, CEOs und CIOs sowie NROs scharf kritisiert.
Inhalt des Verhaltenskodex
Der Verhaltenskodex besteht aus drei Kapiteln: Transparenz, Urheberrecht und Sicherheit und Schutz.
- Transparenz: Dieses Kapitel bietet eine benutzerfreundliche Vorlage für die Dokumentation. Es ermöglicht Anbietern, die erforderlichen Informationen zur Einhaltung der Transparenzanforderungen zu dokumentieren.
- Urheberrecht: Hier finden Anbieter praktische Lösungen, um die Anforderungen des EU-KI-Gesetzes an die Entwicklung einer Strategie zur Einhaltung des EU-Urheberrechts zu erfüllen.
- Sicherheit und Schutz: Dieser Abschnitt skizziert moderne Praktiken zur Adressierung systemischer Risiken, die von den fortschrittlichsten KI-Modellen ausgehen.
Kritik von Bitkom
Der deutsche Digitalverband Bitkom zeigt sich in seiner Kritik am GPAI-Verhaltenskodex relativ diplomatisch. Der Verband sieht darin eine Chance, Rechtssicherheit für die Entwicklung von KI in Europa zu schaffen. Dennoch warnt Susanne Dehmel, Mitglied des Vorstands von Bitkom, dass der Verhaltenskodex nicht als Hemmnis für die Wettbewerbsfähigkeit Europas in der KI-Entwicklung fungieren darf.
Meinungen europäischer CEOs
Über 45 Top-Manager haben in einem offenen Brief an die EU eine klare Botschaft übermittelt: Die EU verliere sich in der Komplexität der Regulierung von künstlicher Intelligenz und gefährde damit ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit. Die Vorschriften seien in einigen Bereichen unklar und in anderen widersprüchlich. Die Manager fordern eine zweijährige Verschiebung der Umsetzung des EU-KI-Gesetzes.
Aufruf von SAP und Siemens zu einem neuen KI-Gesetz
Die CEOs von Siemens und SAP, Roland Busch und Christian Klein, fordern in einem Interview eine grundlegende Überarbeitung des EU-KI-Gesetzes. Sie plädieren für einen neuen Rahmen, der Innovation fördert, anstatt sie zu behindern.
Perspektive von NROs
Die NGO The Future Society, die sich als Vertreterin der Zivilgesellschaft sieht, äußert ebenfalls Kritik an den neuen Richtlinien. Sie ist besorgt, dass US-Technologieanbieter entscheidende Punkte in einer geschlossenen Sitzung abschwächen konnten.
Vier Kritikpunkte der NRO
- Wichtige Informationen gelangen erst nach der Markteinführung an das KI-Büro. Anbieter müssen das Modellbericht erst nach der Bereitstellung teilen, was potenziell gefährliche Modelle unkontrolliert auf den Markt bringen kann.
- Es gibt keinen effektiven Whistleblower-Schutz. Informationen aus dem Inneren sind in kapital- und marktgetriebenen Branchen entscheidend.
- Es sind keine Notfallpläne vorgeschrieben. Solche Protokolle sind in anderen Hochrisikobereichen Standard.
- Anbieter haben umfassende Entscheidungsmacht im Risikomanagement, was durch Lobbyarbeit ermöglicht wurde.
Diese Kritikpunkte verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen die EU bei der Regulierung von KI steht, während sie gleichzeitig die Innovationskraft im digitalen Bereich fördern möchte.