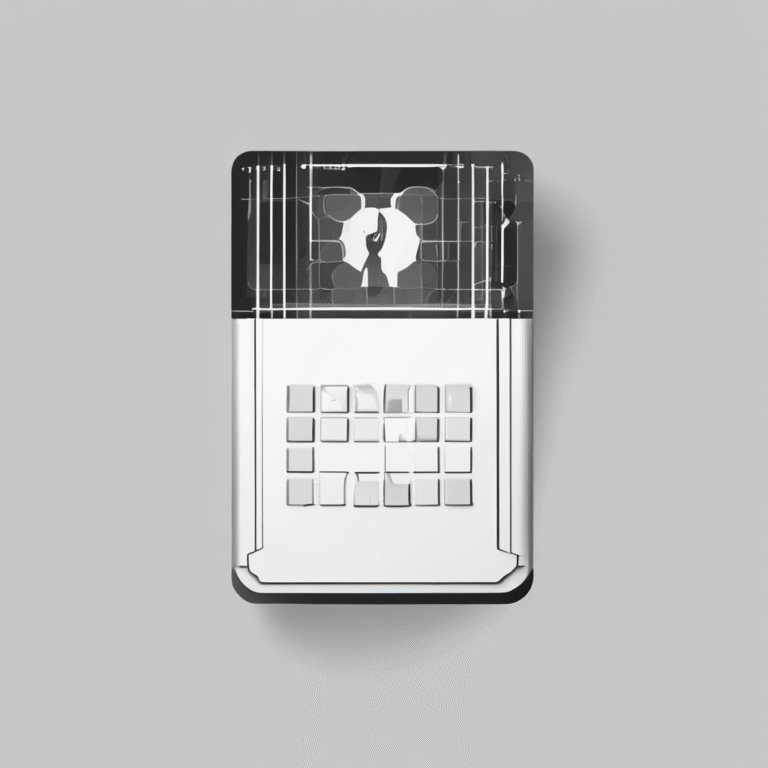Eine mutige neue Welt: Sind wir bereit, die Zügel der Macht an KI zu übergeben?
Algorithmen haben schon lange an der Regierungsführung teilgenommen. Sie bestimmen, welche Stellenangebote Bürger erreichen, welche Steuererklärungen zur Prüfung ausgewählt werden, welche Sozialhilfefälle priorisiert werden und sogar wie Polizeipatrouillen geplant werden.
Vieles davon geschah still und heimlich unter dem Banner der „Entscheidungsunterstützung“, anstatt als offizielle Entscheidungsfindung.
Was die jüngsten Entwicklungen in Albanien und Japan besonders macht, ist, dass die Systeme nicht mehr als versteckte Infrastruktur fungieren.
Die albanische Regierung hat offiziell ihren digitalen Assistenten Diella mit der Verwaltung von Beschaffungsprozessen beauftragt, und die kleine Partei Path to Rebirth in Japan hat erklärt, dass sie eine KI als ihren Führer ernennen wird.
Keiner dieser Fälle stellt einen vollständigen Machtübergang an Maschinen dar. Diella bleibt ein überwacht fungierendes Workflow-Tool, und die japanische Partei hat keine Sitze im nationalen Parlament und muss weiterhin einen menschlichen Vertreter für offizielle Einreichungen benennen.
Dennoch sind diese Schritte signifikant. Sie verschieben die algorithmische Entscheidungsfindung von einer Hinterbühne in eine öffentliche, namentlich anerkannte institutionelle Rolle.
Algorithmische Governance und der Traum von Objektivität
Von Leibniz bis Condorcet stellten Aufklärungsdenker sich vor, Streitigkeiten durch Berechnungen zu ersetzen.
Leibniz schlug sogar einen „universellen Kalkül“ vor, durch den Gegner Streitigkeiten einfach beilegen könnten, indem sie calculemus („lass uns rechnen“) erklärten.
Jeremy Bentham übersetzte diese Vision in utilitaristische Politik und argumentierte, dass das Ziel der Regierungsführung die Maximierung des kollektiven Glücks durch rationale Berechnung sein sollte.
Die zeitgenössische algorithmische Governance scheint dieses Projekt zum Leben zu erwecken. Sie verspricht Entscheidungen, die von Launen und Vorurteilen befreit sind und mit der Regelmäßigkeit eines Funktionsaufrufs getroffen werden.
Die moderne Regierungsführung ringt schon lange mit der Spannung zwischen Ordnung und Autonomie, zwischen dem Versprechen einer unparteiischen Verwaltung und der Angst vor erstickender Kontrolle.
Max Webers Soziologie der Bürokratie bietet den ersten bedeutenden konzeptionellen Anker. Weber beschrieb den idealen modernen Staat als durch Regeln und nicht durch persönliche Launen regiert, gekennzeichnet durch formale Verfahren, schriftliche Aufzeichnungen und hierarchische Aufsicht.
Algorithmische Systeme sind eine logische Fortsetzung dieses Projekts. Sie versprechen Konsistenz, indem sie Ermessensspielräume auf den niedrigsten Ebenen entfernen und Einheitlichkeit durchsetzen.
Doch sie ziehen auch Webers „eisenkäfig“ enger. Aus dieser Perspektive gibt es eine erhebliche historische Kontinuität, bei der algorithmische Governance kein Bruch, sondern eine Intensivierung der Rationalisierung ist.
Governance durch KI
Was neu an diesem Moment ist, ist nicht der Anspruch, die Regierungsführung zu rationalisieren, sondern die Eigenschaften der jetzt eingesetzten Werkzeuge.
Im Gegensatz zu den regelbasierten Systemen früherer Jahrzehnte operiert die zeitgenössische KI auf der Grundlage statistischer Inferenz und nicht auf expliziter Logik. Sie produziert Ausgaben nicht durch die Anwendung transparenter Regeln, sondern durch die Abbildung komplexer Korrelationen in Daten.
Dies ermöglicht Flexibilität und Anpassung, wo Systeme sich selbst aktualisieren können, sobald neue Daten eintreffen.
Doch es führt auch zu Opazität. Entscheidungsträger könnten es schwierig finden, zu erklären, warum eine bestimmte Empfehlung abgegeben wurde oder die Kette der Argumentation hinter einem Ergebnis nachzuvollziehen.
Algorithmische Governance heute schränkt nicht nur Webers Käfig ein; sie riskieren, sichtbare Gitter durch unsichtbare zu ersetzen.
Ein weiterer entscheidender Unterschied ist die Skalierung und Granularität. Frühere Verwaltungssysteme konnten nur verallgemeinern.
Sie wandten uniforme Regeln auf breite Klassen von Fällen an. Machine Learning-Modelle hingegen ermöglichen eine Mikro-Differenzierung. Risikobewertungen, Entscheidungsfindungen zur Berechtigung und politische Stupser können bis auf Nachbarschaften oder Einzelpersonen abgestimmt werden.
Dies bringt sowohl Chancen als auch Bedenken mit sich. Einerseits können Ressourcen mit beispielloser Präzision gezielt werden, was möglicherweise Abfall und Ungleichheit verringert.
Andererseits kann eine solch feingranulare Governance die Vorstellung eines öffentlichen Raumes fragmentieren und die kollektive Behandlung durch individualisierte Optimierung ersetzen, was die politische Rechtfertigung erschwert: Warum wurde mein Fall anders behandelt als der meines Nachbarn, wenn kein Mensch jemals entschieden hat?
Frühe Fallstudien
Algorithmische Systeme unterscheiden sich von früheren administrativen Technologien in drei wichtigen Aspekten. Sie sind anpassungsfähig, sie basieren auf probabilistischer Inferenz anstelle fester Regeln, und sie operieren in einem Maßstab, der Millionen von Fällen gleichzeitig beeinflussen kann.
Diese Eigenschaften ermöglichen es Regierungen, Ressourcen mit beispielloser Präzision zuzuweisen und Probleme vorherzusehen, bevor sie eskalieren.
Sie verstärken auch die Auswirkungen von Fehlern, betten Vorurteile auf möglicherweise schwer erkennbaren Wegen ein und machen die Aufsicht komplexer.
Statt diese Entwicklungen als PR-Stunts abzulehnen oder sie als Vorboten einer Maschinenherrschaft zu fürchten, sollten wir die Experimente in Albanien und Japan als frühe Fallstudien betrachten.
Sie bieten die Möglichkeit, die Normen, Prüfpraktiken und rechtlichen Rahmenbedingungen zu gestalten, die die algorithmische Entscheidungsfindung regeln, bevor sie tief verwurzelt ist.
Albanien und Japan haben, absichtlich oder nicht, die algorithmische Governance sichtbar gemacht. Die Aufgabe besteht nun darin, zu entscheiden, wie man sie legitim, anfechtbar und im Einklang mit demokratischen Prinzipien hält, bevor das nächste Amt ein digitales Namensschild erhält.